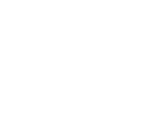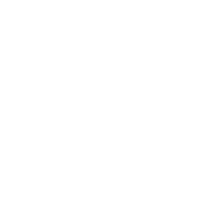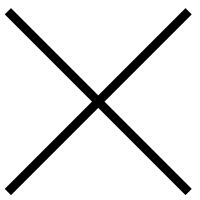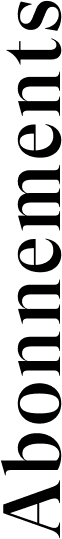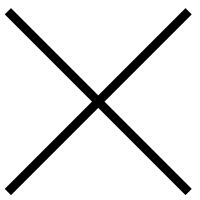Als Konzertmeisterin kennen Sie die Perspektive des Orchesters sehr gut. Wie verändert sich Ihr Erleben der Musik, wenn Sie nun die solistische Rolle übernehmen und das Orchester Sie begleitet?
Danke für diese sehr interessante Frage! Wir haben hier in der Tat mit zwei vollkommen verschiedenen Herangehensweisen zu tun, die miteinander kaum vergleichbar sind.
Es ist ein großer Unterschied, ob ich als Teil der Gruppe der 1. Violinen auftrete oder ein Solostück von 35 Minuten Länge auf der Bühne spiele, klanglich wie gestalterisch.
Als Solistin bin ich selbstverständlich zumeist tonangebend, während die Rolle als Orchestermusikerin viel mehr mit Anpassungsfähigkeit, dem Verschmelzen mit der Gruppe, sowie dem Aufgreifen der Impulse des Dirigenten und deren möglichst präzisen Umsetzung zu tun hat. Dabei ist die Freude am Zusammenspiel und das gemeinschaftliche Erleben eines Werkes essenziell!
Wie unterschiedlich diese beiden Arten auch sind, so haben beide natürlich ihren eigenen Reiz. Die Schwerpunkte verschieben sich, so auch die Aufgabenverteilung.
Doch selbst beim solistischen Spielen begreife ich mich immer als eine zwar wichtige, jedoch immer noch eine einzelne Zeile unter den vielen Stimmen in der Partitur. Nur in der perfekt aufeinander abgestimmten Interaktion mit den anderen Musikinstrumenten kann die Solostimme am besten zur Geltung kommen, nur so macht die musikalische Aussage am meisten Sinn.
Und vielleicht gerade deshalb war es mir wichtig, in Mannheim ein Violinkonzert aufzuführen, in dem die Rolle des Orchesters nicht nur auf die Begleitfunktion reduziert wird. Bartóks Werk ist anspruchsvoll nicht nur aus der Sicht der Solovioline, sondern ist ein Gesamtkunstwerk, das einige spannende Aufgaben für das Orchester bereithält. Für mich ist es eine besondere Auszeichnung, dieses große und vergleichsweise nicht so oft gespielte Violinkonzert gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne zu bringen!
Bartóks Musik ist bekannt für ihre rhythmische und harmonische Eigenständigkeit. Wie finden Sie ihren persönlichen Ausdruck in diesem Werk, und welche musikalischen Aspekte liegen Ihnen besonders am Herzen?
Die Suche nach dem persönlichen Ausdruck in diesem Stück ist für mich untrennbar mit dem Verständnis der Musiksprache Bartóks, seinem Erleben des Zeitgeschehens, sowie seinen Wurzeln als Musiker verbunden.
Wie schon angemerkt ist Bartók in seinen Partituren recht eindeutig. Vieles wird sehr klar, wenn man das Stück näher kennenlernt, Rätselraten gibt es hier tatsächlich nicht.
Doch der musikalische Ausdruck wird natürlich nicht allein aus den Metronomzahlen geboren. Es ist sehr wichtig, die Wurzeln dieser Musik zu studieren, bzw. ihren nationalen Hintergrund. Ungarn war und ist nach wie vor das Heimatland herausragender Geiger, deren Spielweise wertvolle Hinweise zum Verständnis der Klangsprache Bartóks und gleichzeitig eine Inspiration mit sich bringen. Es ist vor allem eine enorme Kraft, tonliche Reinheit, ein durchaus differenziertes Vibrato und eine freie oder besser gesagt, im Zeitmaß frei wirkende, zuweilen improvisierende Rhythmik, die für diese Art zu spielen bestimmend sind.
Zurück zu dem Violinkonzert. Der erste Satz wirkt fragmenthaft, die Stimmungswechsel sind manchmal sehr abrupt, als wäre man innerlich zerrissen. Die Solovioline (der Erzähler), die das Stück mit einer Cantilene beginnt, erlebt die Außenwelt (das Orchester) zunehmend bedrohlich und chaotisch. Die langsamen, lyrischen Abschnitte beruhigen zwar immer wieder das Geschehen, die Entwicklung ist jedoch unausweichlich, die Spannung steigt bis hin zum orchestralen (beinahe) Kollaps, mit dem die Kadenz eingeleitet wird. Dieser Monolog der Solovioline ist für meine Begriffe absolut einzigartig in der Musikgeschichte. Fast nichts aus dem musikalischen Material des ersten Satzes kommt in der Kadenz vor, was normalerweise üblich ist. Sie wirkt wie eine verzweifelte Auseinandersetzung mit dem Geschehen, wie ein Ringen um ein Weiterkommen, im Leben wie in der Musik. Der Wirbel der inneren, sich streitenden Stimmen wird gegen Schluss der Kadenz bis zum Einsetzen des Orchesters immer heftiger. Und hier geschieht ein musikalisches Wunder: das Wiederkommen des ersten Themas, aber dieses Mal transformiert, mit einer ganz anderen Orchestrierung. Es wirkt wie eine Erlösung, wie ein Geistesblitz, aber auch wie ein "Nachhausekommen". Dieser Moment gehört ohne Zweifel zu den schönsten und berührendsten Bartóks...
Ganz andere Stimmung im zweiten Satz, dessen Thema nach einer alten fernen Volksweise klingt. Die Solovioline agiert hier, als wäre es eine Stimme nicht von dieser Welt, für den Solisten tonlich und rhythmisch eine schöne Herausforderung. Schließlich der dritte Satz, auch hier mit versteckten Variationen, die auf groteske Weise den ersten Satz imitieren und dabei umkehren. Dazwischen plötzlich die Anspielung auf einen Walzer, dieser ist aber schon zu Ende bevor er in Fahrt kommen konnte. Der Schluss des Konzerts setzt noch eins drauf mit vollem Orchesterapparat und opulenten Klängen!